Cyberkriminalität und Fakenews
Veröffentlicht: Freitag, 19.06.2020 13:53
Cyberkriminalität lässt sich in zwei Bereiche aufteilen. Im engeren Sinn sind damit Angriffe gegen Datennetze und Telekommunikationsstrukturen gemeint. Im weiteren Sinne gehören dazu aber auch alle Straftaten, bei denen Computer als Mittel zum Zweck benutzt werden, also zB. beim Abfangen von Daten, die dann zur Erpressung von Opfern genutzt werden.
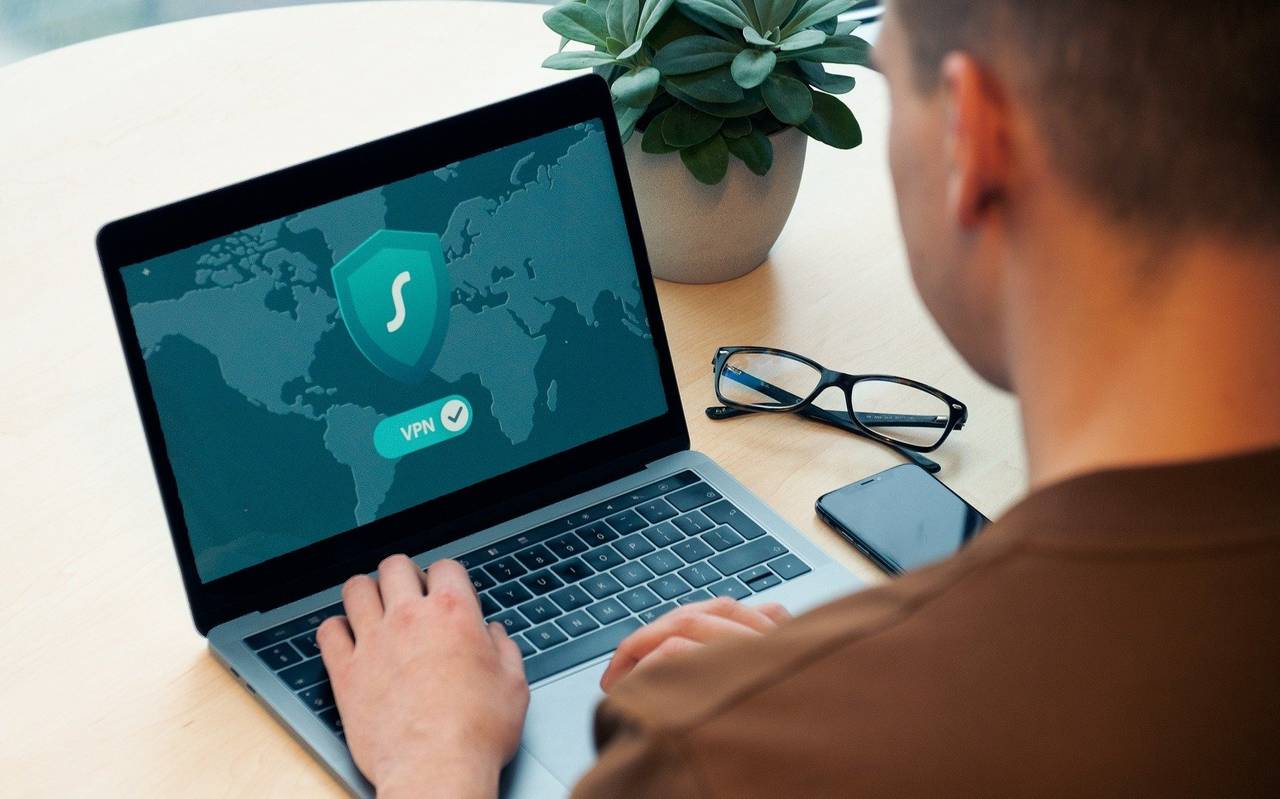
2018 hat die Polizei in Deutschland insgesamt 358.864 Straftaten im gesamten Bereich Cyberkriminalität erfasst, mit einem geschätzten registrierten Schaden von 60 Millionen Euro. Die Dunkelziffer ist hier aber sehr hoch, der geschätzte nicht registrierte Schaden liegt bei etwa 100 Milliarden Euro.
Die Täter sind hierbei nicht mehr nur große Hackergruppen mit viel Fachwissen, sondern Cyberkriminalität ist auch zum Angebot geworden. Entsprechende Programme können einfach im Internet gekauft werden und runtergeladen werden. Damit können auch Privatpersonen ohne großes technisches Wissen zu Tätern im Netz werden.
Fake News erkennen
Eine immer größere Gefahr im Netz stellen Fake News dar, also Falschinformationen, die über Facebook, Twitter oder WhatsApp verbreitet werden. Laut einer Forsaumfrage aus dem Jahr 2019 haben 40% der Deutschen Probleme damit, Fake News zu identifizieren. Hier ein paar nützliche Tipps:
Schaut euch das Profil an, über den eine Nachricht z.B. bei Facebook verbreitet wird. Häufig werden Profile nämlich nur erstellt, um Fake News zu streuen. Solche Profile sind deshalb oft sehr neu, haben keine oder nur wenige Freunde und oft auch kein Profilbild
Häufig führen solche Beiträge auf angebliche Nachrichtenseiten. Schaut euch an, ob dort der Autor der Nachricht genannt wird und ob es ein Impressum gibt, es gibt für Nachrichtenseiten nämlich eine Impressumspflicht. Wenn das nicht vorhanden ist, sind es wahrscheinlich Fake News.
Prüft den Inhalt des Beitrags bzw. der Meldung. Häufig sind die nicht neutral, sondern es wird jemand beschuldigt. Gebt das, was da steht bei Google ein und sucht, ob es auch auf bekannten Nachrichtenseiten thematisiert wird.
Es gibt auch mehrere Plattformen im Netz, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Fake News zu sammeln und richtigzustellen. Hier ein paar Links:
https://correctiv.org/faktencheck/
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/
Rückwärtssuche von Bildern
Oft werden Fotos im Netz aus dem Zusammenhang gerissen und im Rahmen von Fake News verbreitet. Dafür werden zum Beispiel Jahre alte Fotos als neu verkauft oder Fotos aus dem Ausland nach Deutschland verlegt. Mithilfe einer sogenannten Rückwärtssuche kann man das herausfinden. Dabei durchsuchen Suchmaschinen das Internet nach Seiten, auf denen dieses Foto zu sehen ist und listen dann die Seiten auf. Hier ein paar Links:
https://www.google.de/imghp?hl=de, dort auf das Kamerasymbol in der Suchleiste klicken
Deepfake – gefälschte Videos
Deepfakes – Das sind Videos von Personen, die eine Situation zeigen, die so gar nicht stattgefunden hat. Möglich macht das Künstliche Intelligenz. Eines der bekanntesten Deepfakes ist ein Video von Barack Obama aus dem Jahr 2018, in dem er angeblich Donald Trump beleidigt – in Wirklichkeit hat ein Schauspieler sich gefilmt und das, was er gesagt hat per Künstlicher Intelligenz und Videos und Fotos von Obama zu einem neuen Video gemacht. Gerade im politischen Kontext können sie falsche Informationen verbreitet und Menschen manipuliert werden. Am häufigsten betroffen von Deepfakes sind übrigens Frauen und dabei geht es einer niederländischen Untersuchung zufolge in 96 Prozent der Fälle um Pornografie - meistens mit den Gesichtern bekannter Schauspielerinnen.
Deepfake erkennen:
- Checkt den Kopf – häufig liegen die Haare komisch, oder es gibt seltsame Verformungen am Gesicht, z.B. an den Ohren
- Bewegungsabläufe erscheinen unnatürlich
- Der Inhalt passt eigentlich nicht zu dem, was diese Person sonst macht oder sagt – am besten ist es dann, nochmal nach weiteren Quellen zu suchen, die das auch so wiedergeben
Zoom, Skype, Hangouts und Co – wie sicher sind Videokonferenztools?
Mal eben mit der Oma skypen, mit den Kollegen in der Zoom-Konferenz den Tag besprechen oder Abend mit den Freunden zusammen eine Online-Party per Houseparty organisieren – in der Corona-Krise boomen Videokonferenztools. Einige standen in den letzten Wochen in der Kritik, größere Sicherheitslücken zu haben, allen voran das Programm „Zoom“ – hier sollen sich Fremde in die Konferenzen geschaltet haben und Daten von Nutzern weitergegeben worden sein. Zoom hat das laut eigenen Angaben aber mittlerweile behoben. Klar ist, die Kommunikation übers Netz ist Nie zu 100 Prozent sicher, aber ihr könnt beim Videoanbieter auf einige Dinge achten:
- Verschlüsselung – das Programm sollte die Konferenzen am besten mit einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übertragen
- Datenschutzrichtlinie checken und verstehen – wofür erhebt das Unternehmen welche Daten? Hier sollte sichergestellt sein, dass die Inhalte nicht für eigene Zwecke ausgewertet oder an Dritte weiter gegeben werden
- Wer ist im Meeting? – Während der Konferenz solltet ihr schauen, ob nur die Leute dabei sind, die ihr dazu eingeladen habt
- Bei Apps auf dem Smartphone ist wichtig, vorm Installieren zu schauen, worauf die App Zugriff haben will – manche Apps funktionieren nur, wenn sie Fotos, den Standort oder/und die Kontakte abrufen können.




